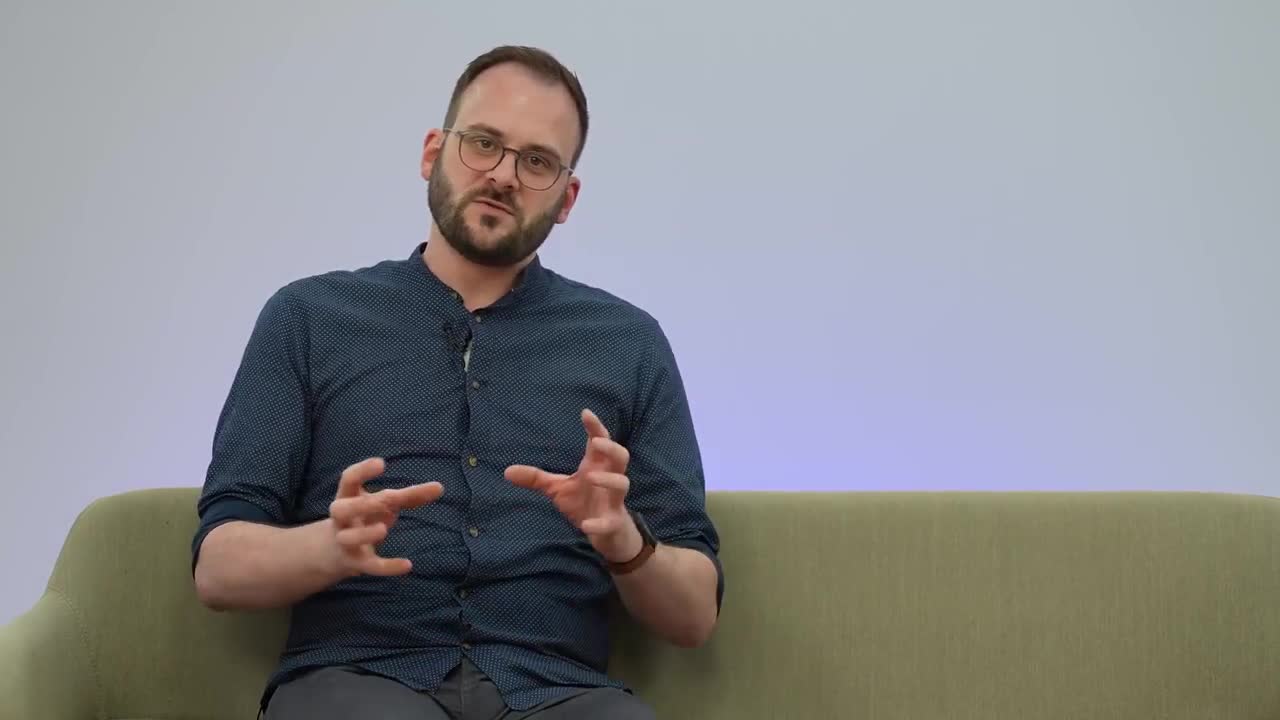Pflege ist zentral – auch unter ECMO
Die ECMO (Extrakorporale Membranoxygenierung) darf kein Selbstzweck sein. Das betonen Tobias Wittler und Tobias Ochmann vom ECMO-Netzwerk. Trotz des komplexen technischen Settings dürfen grundlegende pflegerische Aufgaben nicht in den Hintergrund treten – vielmehr bleiben Mobilisation, Ernährung, kognitive Förderung, psychosoziale Begleitung sowie alle anderen Aspekte der Patient:innenversorgung elementar und müssen Hand in Hand gehen mit der Expertise, die Maschine zu bedienen. Die Fähigkeit, Technik mit pflegerischer Exzellenz zu verbinden, ist Kern der professionellen Identität. „Unsere Kompetenz zeigt sich darin, den Umgang mit ECMO so zu beherrschen, dass wir unsere pflegerischen Tätigkeiten nahtlos in den Behandlungsalltag integrieren können. So stellen wir sicher, dass unsere Patient:innen trotz des technischen Aufwands nicht benachteiligt werden und alle notwendigen pflegerischen Maßnahmen weiterhin erhalten“, so Tobias Wittler.
Klinische Einschätzung ist Kernkompetenz
Was genau ECMO-Pflege leisten muss, ist in Deutschland bislang nicht verbindlich definiert. Dabei sind die Anforderungen hoch – sowohl fachlich als auch in der situativen Entscheidungsfindung. Pflegefachpersonen müssen nicht nur die typischen intensivmedizinischen Kompetenzen mitbringen, sondern auch ein tiefes Verständnis für die zugrunde liegende Erkrankung, potenzielle Komplikationen und die Mechanismen der ECMO-Therapie besitzen.
Gerade im ECMO-Setting ist das elementar, da Pflegende oft die Ersten sind, die Veränderungen im Zustand der Patient:innen wahrnehmen. Diese frühen Beobachtungen können entscheidend sein – insbesondere bei akuten Verschlechterungen. „Wenn wir eine kritische Veränderung feststellen, müssen wir sofort reagieren können – und nicht erst auf jemanden warten, der vielleicht eine Idee hat. Diese Zeit kann man nicht nachholen“, erläutert Tobias Ochmann. Dabei geht es um mehr als Vitalzeichen, sondern um eine differenzierte Einschätzung des Patient:innenzustands: „Ich muss wissen, was ich dem Patienten bzw. der Patientin heute zumuten kann. Wie steht es um Angst, Schmerz, Delir, Wachheit, Kooperationsfähigkeit? Nur so kann ich pflegerische Maßnahmen gezielt planen – und gegebenenfalls auch sofort reagieren.“
Technische Expertise im komplexen Setting
Pflegefachpersonen müssen die ECMO nicht nur bedienen, sondern auch genau wissen, welche Auswirkungen Veränderungen im Therapieverlauf haben können. Veränderungen an der ECMO wirken sich auf Kreislauf, Atmung und Gesamtzustand aus – oft in Kombination mit anderen Faktoren. „Technisches Wissen muss tief verankert sein, um Zusammenhänge korrekt einzuordnen. Es geht nicht um eine Variable – oft verändern sich mehrere Parameter gleichzeitig. Dieses Zusammenspiel zu verstehen und entsprechend zu handeln, ist anspruchsvoll“, so Tobias Wittler.
In vielen Kliniken übernehmen Pflegekräfte zudem Aufgaben, die in anderen Häusern bei der Kardiotechnik liegen – etwa beim Aufrüsten des Geräts oder im Fuhrparkmanagement. Das erfordert zusätzliche Expertise und hohe Verantwortungsbereitschaft.
Vielschichtige Fähigkeiten in Grenzsituationen
ECMO verschafft Zeit – keine Heilung. Diese Realität ist Fachkräften bewusst, jedoch erleben Patient:innen und Angehörige die Situation oft anders. Sie sehen stabile Vitalzeichen auf dem Monitor und deuten sie als Zeichen der Hoffnung – ohne die Tragweite der zugrunde liegenden Erkrankung erfassen zu können. Denn wenn absehbar ist, dass keine realistische Chance auf Heilung der Grunderkrankung besteht, bietet ECMO keine Perspektive. Dann müssen Entscheidungen getroffen werden: Soll die Maßnahme fortgeführt oder beendet werden? Wie lassen sich solche Entscheidungen respektvoll und verständlich vermitteln? Hier zeigt sich die psychosoziale Dimension der ECMO-Pflege. „Manchmal geht es auch darum, mehr Zeit für eine Entscheidungsfindung oder für Gespräche mit den Angehörigen zu schaffen – damit niemand vor vollendete Tatsachen gestellt wird“, erklärt Wittler.
Daneben sind viele Patient:innen, die über längere Zeit an der ECMO versorgt werden, wach und bei vollem Bewusstsein – und realisieren, dass sie ohne das Gerät nicht überleben können. „Das macht etwas mit ihnen – und auch mit uns als Pflegekräften“, sagt Wittler. Andere erleben die ECMO im Rahmen einer Bridge-to-Transplant-Strategie als letzte Chance auf ein Spenderorgan.
Je nach persönlicher Wahrnehmung schwankt das Erleben zwischen Zuversicht und Überforderung: „Ich will einfach nicht an Schläuchen hängen. Das ist für mich keine Lebensqualität“, berichten manche. Diese Beispiele zeigen, wie individuell die psychosoziale Begleitung gestaltet sein muss. Pflegefachpersonen müssen Unsicherheiten auffangen, Ängste ansprechen, realistische Perspektiven aufzeigen – und gleichzeitig in der Lage sein, kritische Therapieentscheidungen mitzutragen und zu kommunizieren.
Hier wird deutlich: ECMO-Pflege ist weit mehr als Technik und Überwachung. Sie ist ein hochkomplexer, zwischenmenschlich und emotional anspruchsvoller Prozess, der nicht nur medizinisches Wissen, sondern ethische Reflexion und empathische Präsenz verlangt.
Teamkompetenz zählt
Ob akuter Notfall, ethisches Dilemma oder technische Komplikation – ECMO erfordert interdisziplinäre Zusammenarbeit auf höchstem Niveau. Pflegefachpersonen sind dabei nicht nur beteiligt, sondern zentral eingebunden. „ECMO funktioniert nie allein. Es steht und fällt mit dem Team“, betont Tobias Ochmann. „Je komplexer die Therapie, desto wichtiger ist die enge Verzahnung aller Teammitglieder.“ Auch externe Fachstellen wie Ethikkomitees oder Palliativdienste werden bei Bedarf hinzugezogen – und Pflege ist Teil dieser kommunikativen Schnittstellenarbeit.
Jeder Fall ist einzigartig. Es gibt keine Standardlösung – aber die Möglichkeit, gemeinsam die individuell beste Entscheidung zu treffen. Dafür braucht es Pflegende, die klar kommunizieren und sich in komplexen Abstimmungsprozessen sicher bewegen können.
Ein Beispiel: die Mobilisation von Patient:innen. Um Folgeschäden zu vermeiden, muss frühzeitig mobilisiert werden – ein komplexer Vorgang. Pflegefachkräfte tragen hier nicht nur zur praktischen Umsetzung bei, sondern koordinieren und verbinden – zwischen Physiotherapeut:innen, Patient:innen und Angehörigen.
Einstieg mit System – aber wie?
Ein strukturierter Einstieg in die ECMO-Pflege ist essenziell – insbesondere für neue Kolleg:innen.
In Deutschland gibt es verschiedene Qualifizierungsangebote, doch diese allein reichen oft nicht aus. „Letztendlich kann man diese Angebote nutzen, aber jede Klinik muss für sich überlegen, wie sie adäquate Schulungen sicherstellt“, so Tobias Wittler. Denn im hektischen Klinikalltag ist die konsequente Einarbeitung oft eine Herausforderung. Im Netzwerk werden deshalb verschiedene Schulungsformate diskutiert – etwa VR-Trainings oder Online-Simulationen: „Da ist sicherlich noch ganz viel Luft nach oben.“